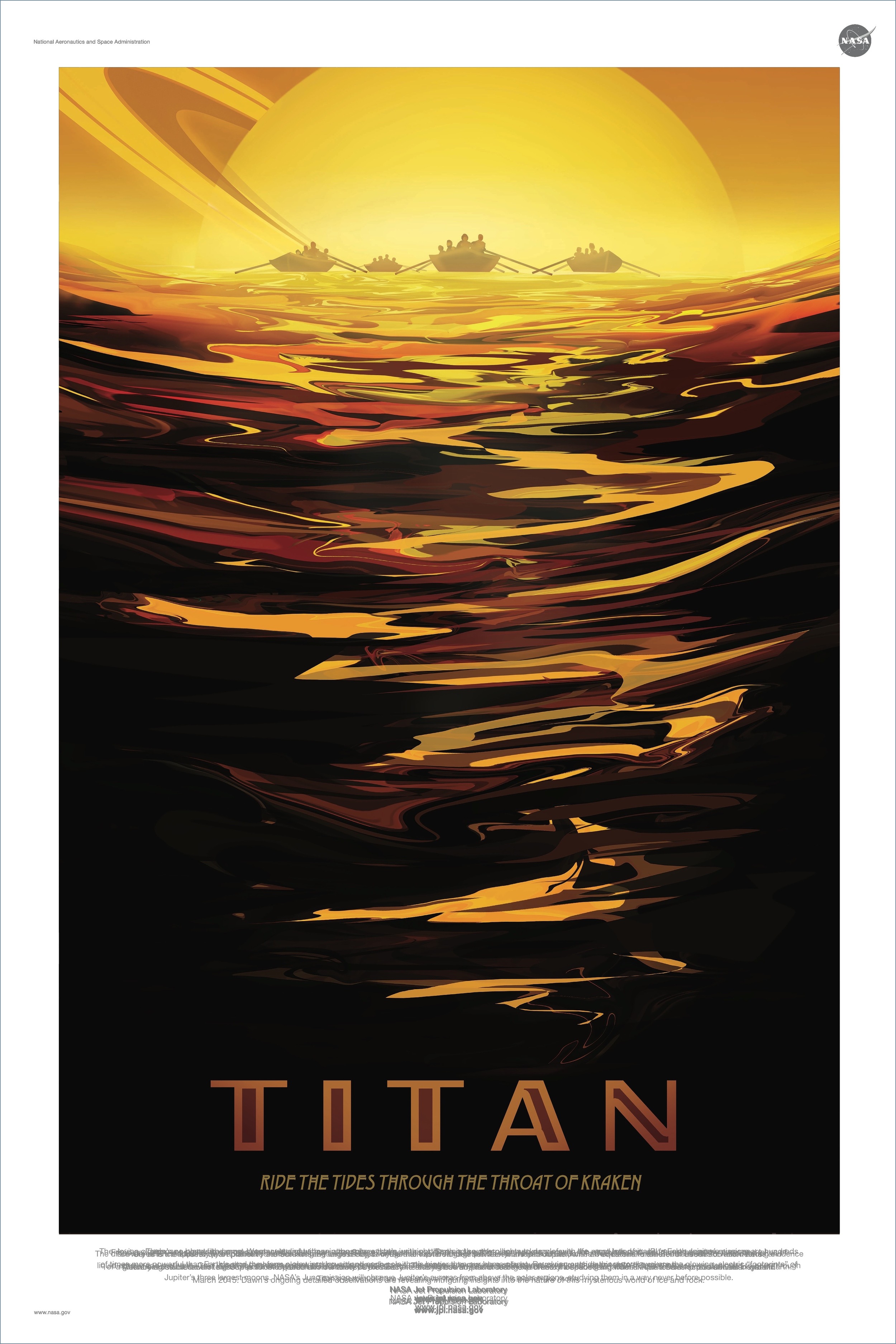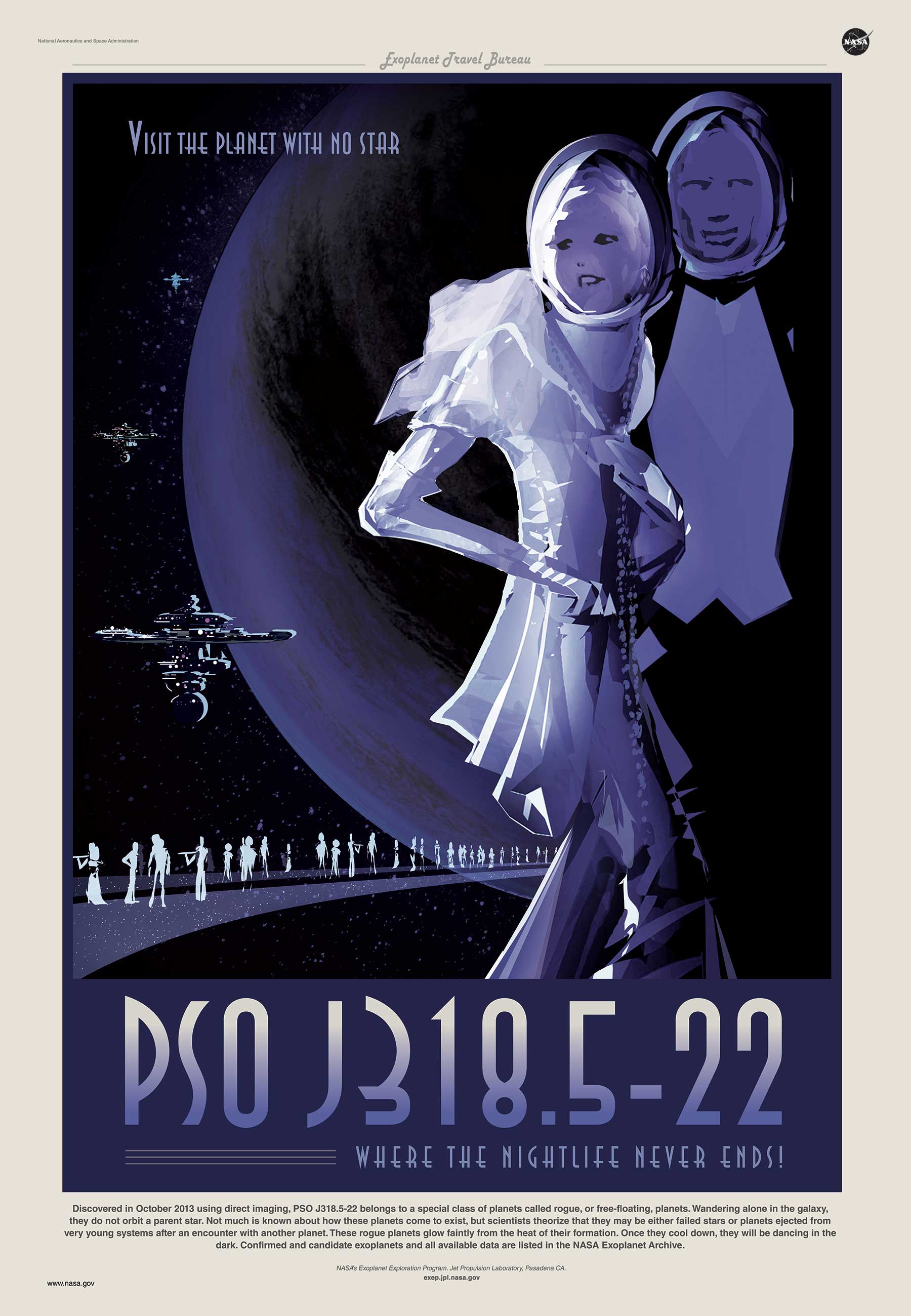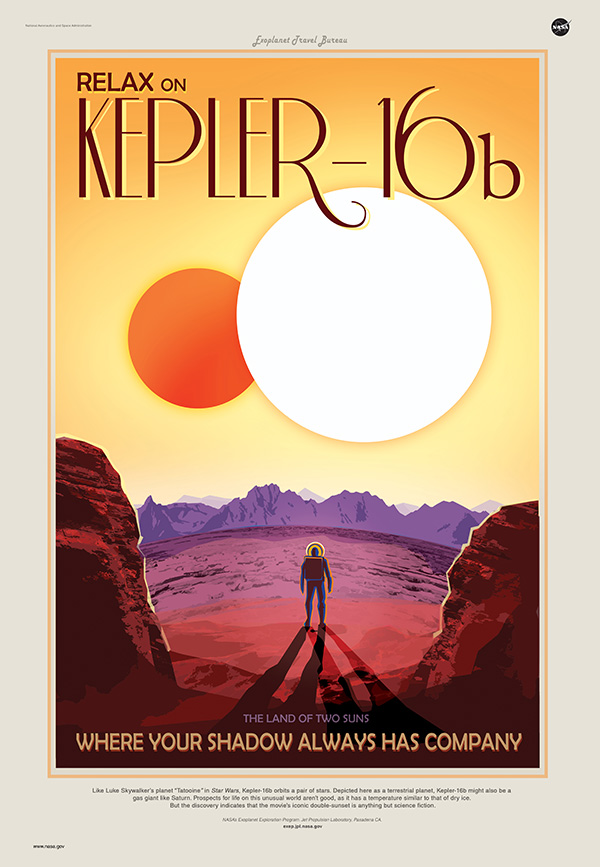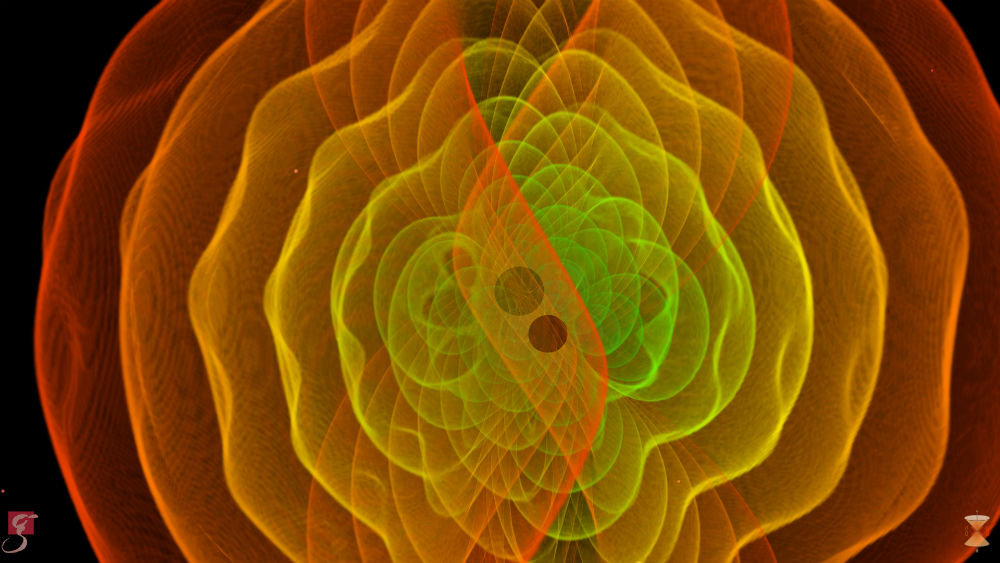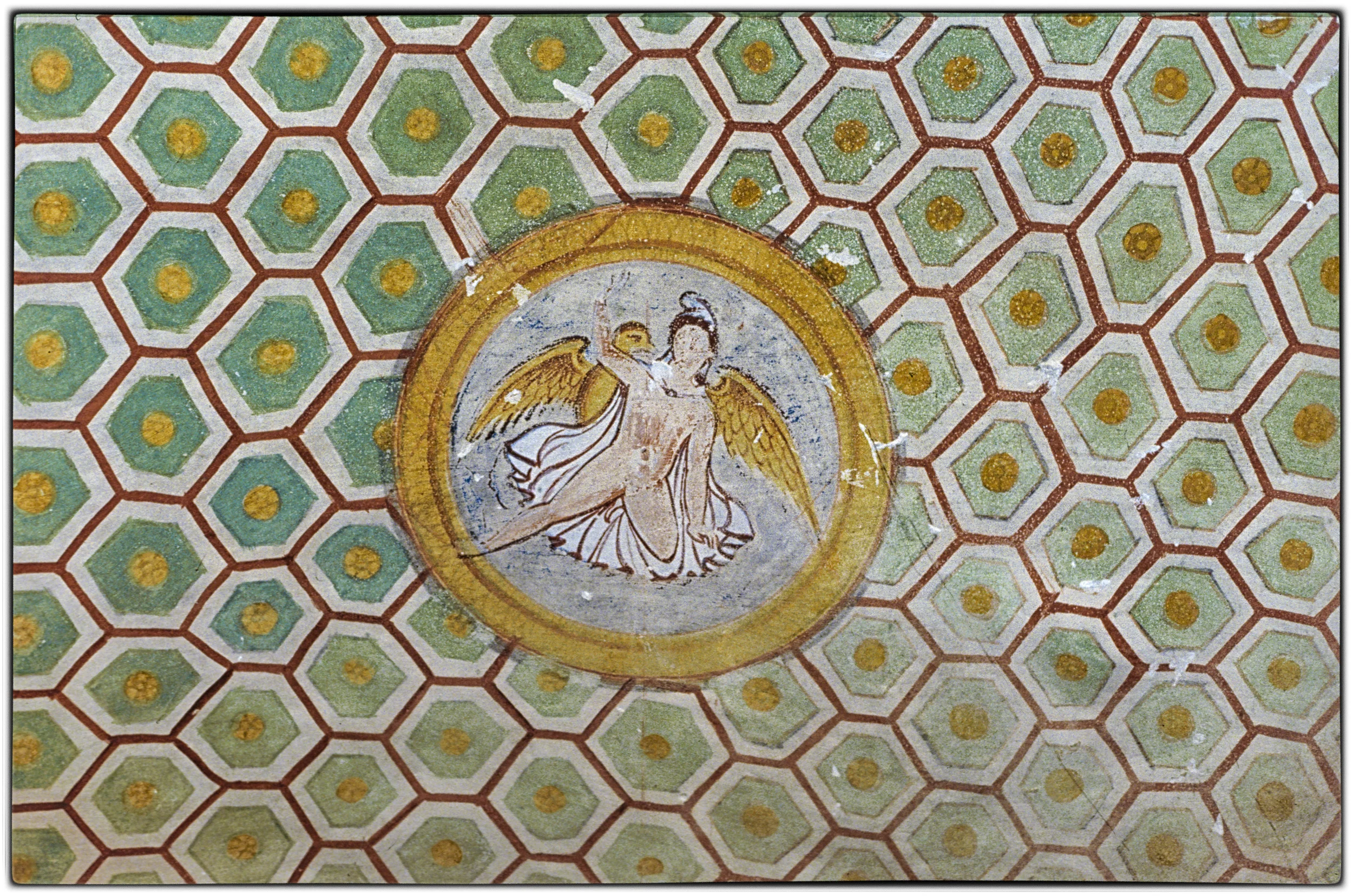Im Anfang war das Pilotprojekt. Zwei Pilotprojekte, um genau zu sein. Das Crowdsourcing Projekt „Reden Sie mit“ und LOIS, das „Lab for Open Innovation in Science“. Während bei ersterem neue Fragen zum Thema psychische Gesundheit generiert wurden, bot zweiteres Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein Training zum Einsatz von Open Innovation Methoden in der Wissenschaft an. Nach vier Jahren Arbeit und Erfahrung setzt die Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) auf Basis dieser beiden Projekte den nächsten Schritt. Sie richtet das „Open Innovation in Science and Research Center“ (OIS) ein.
Das weltweit erste seiner Art. Insofern ebenfalls ein Pilotprojekt.
„Die Ergebnisse der Pilotprojekte ,Reden Sie mit“ und LOIS waren so gut und die – auch internationale – Resonanz so ermutigend, dass wir jetzt unser Engagement zu Open Innovation in Science langfristig ausbauen“, so Josef Pröll, Präsident der LBG, in Alpbach. „Wir sehen hier eine Entwicklung, die über Open Science und Open Access hinausgeht. Die zielgerichtete Öffnung wissenschaftlicher Prozesse oder die Zusammenarbeit mit unüblichen Wissensgeberinnen und –gebern werden weiter an Bedeutung gewinnen“, erklärt Pröll.
Als Schlagworte sind Open Innovation und Open Access seit geraumer Zeit schon in aller Munde. Sie werden zusehends in Diskussionen, Publikationen und Ankündigungen eingesetzt. Oft genug als nebuloses Versprechen aber fesch, weil neu.
Dem suchen mehr und mehr Initiativen etwas entgegenzusetzen. Peter Kraker vom Know Center der TU Graz zum Beispiel hat gemeinsam mit anderen die „Vienna Principles – a Vision for Scholary Communication“ und damit Prinzipien der Wissenschaftskommunikation in Zeiten von Citizen Science formuliert. Das OIS Center der Ludwig Boltzmann Gesellschaft fokussiert nun ab Herbst 2016auf die Entwicklung von Methoden, Trainings und Service für Wissenschaft und Gesellschaft. Sie schaffen damit eine methodische Basis für einen Begriff, sie definieren ihn. Untersucht werden unter anderem Crowdsourcing zur Generierung neuer Forschungsfragen oder Technological Competence Leveraging zur Identifikation neuer Anwendungsbereiche erfolgreicher bestehender Technologien. Die Ergebnisse fließen direkt in die Forschungsinstitute der LBG ein und werden auch extern angeboten.
„Mit dem OIS Center schaffen wir einen inspirierenden Raum für experimentelles und interdisziplinäres Arbeiten in der Wissenschaft und steigern das Bewusstsein für offene Innovation. Das OIS Center verspricht eine strukturelle und nachhaltige Verbesserung der Forschung in Österreich und ist ein gezielter Beitrag zur Weiterentwicklung des Innovationssystems“, unterstreicht Claudia Lingner, Geschäftsführerin der LBG.
2018 wird auf Basis des Centers und seiner Arbeit schließlich ein OIS Forschungsinstitut eingerichtet werden, wobei ab 2017 im Rahmen eines „Ideas Labs“ 25 ausgewählte internationale Wissenschaftler das Forschungsprogramm des Instituts experimentell konkretisieren. „Im Grunde genommen ist es unser Ziel“, so Projektkoordinator Patrick Lehner, „dass in zehn Jahren niemand mehr betonen muss, dass er Open Innovation betreibt, einfach weil es eine Selbstverständlichkeit geworden ist.“ Noch ist es eine Innovation, die unter anderem bei der Max Planck Gesellschaft, der Harvard Medical School und beim CERN auf Interesse stößt. (fvk)
© Todd Quackenbush/Unsplash